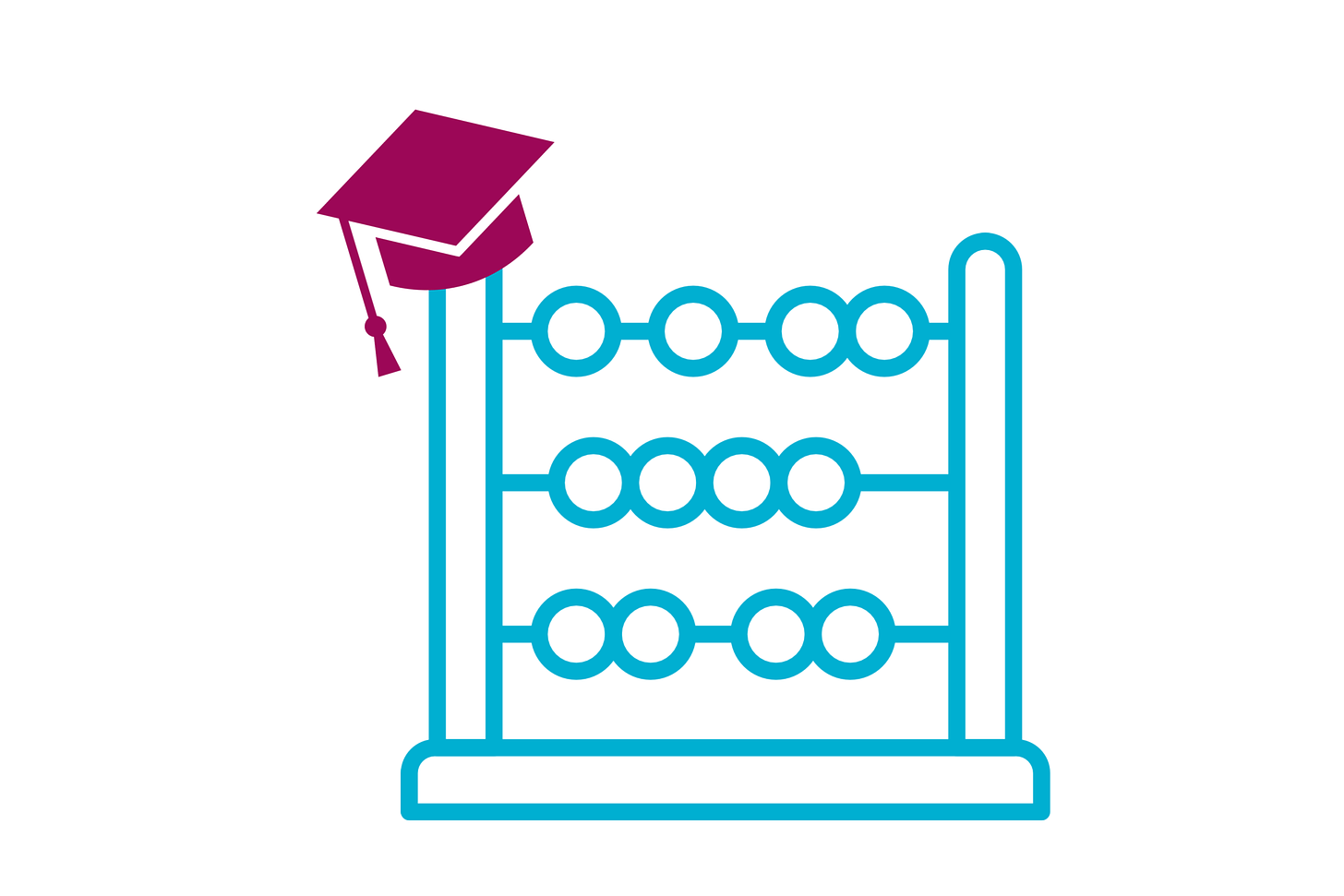4+2 = Fail x 3
Jede vernünftige Reform der Postdoc-Phase im WissZeitVG muss (mindestens) drei Anforderungen genügen: Erstens muss sie sicherstellen, dass mehr unbefristete Stellen entstehen, die frühzeitig und unter ebenso realistischen wie transparenten Bedingungen vergeben werden. Zweitens muss sie eine angemessene Ausgestaltung ermöglichen, die verschiedenen Fachkulturen Rechnung tragen kann. Nicht zuletzt muss eine solche Reform drittens faire Teilhabechancen für alle eröffnen – nicht nur für diejenigen, die bereits mit Startvorteilen in das deutsche Wissenschaftssystem einsteigen können. Der Vorschlag 4+2 ist vor diesem Hintergrund gleich in dreifacher Hinsicht ungenügend.
Mehr frühzeitige Perspektiven: Fehlanzeige
Warum mit einer 4+2-Regelung statt mehr frühzeitiger Perspektiven einfach nur eine noch stärker beschleunigte Personalrotation zu erwarten ist, ist schon vielfach dargelegt worden, u.a. im lesenswerten neuen Statement der #ProfsFürHanna #ProfsFürReyhan, das hier eingesehen und mitgezeichnet werden kann. Wenn einer Befristung mit Anschlusszusage ganze vier Jahre vorausgehen, ist ohne zusätzliche Maßnahmen nicht zu erwarten, dass Stellen mit Anschlusszusage überhaupt angeboten werden. Die Anforderung an eine Reform, mehr frühzeitige Perspektiven zu schaffen, scheitert bei 4+2 also gleich doppelt: Zur erforderlichen unbefristeten Besetzung von deutlich mehr Stellen kommt es so aller Voraussicht nach nicht – und Postdocs müssen weiterhin vier Jahre in Ungewissheit darüber leben und arbeiten, ob sie eine dauerhafte Perspektive im Wissenschaftssystem erhalten, während es zugleich intransparent bleibt, was genau in welchem Umfang für die wenigen Professuren und Dauerstellen zu leisten ist. Dass Postdocs in der Regel zwei Jahre früher erfahren als jetzt, dass sie aus dem System fliegen, lässt sich wohl kaum als Erfolg einer solchen Regelung verkaufen.
4+2 lässt keine sinnvolle Ausgestaltung zu
Aber ein 4+2-Modell verfehlt nicht nur die Zielsetzung, die überbordenden Befristungen von Postdocs im deutschen Wissenschaftssystem einzudämmen – es geht auch schlicht an der Realität wissenschaftlicher Praxis vorbei. Und das dürfte für viele Fächer gelten. Denn das 4+2-Modell vereint die Nachteile der eben skizzierten perspektivlosen Vier-Jahres-Phase mit denen einer zweijährigen Anschlusszusage-Befristung, die sich nicht sinnvoll ausgestalten lässt. Was soll Gegenstand einer Zielvereinbarung sein, die innerhalb von nur zwei Jahren sollte erfüllt werden können? Dass ein entsprechendes Modell wenig Sinn ergibt, fängt bei der Akquise von Drittmitteln an, deren Rolle in Zielvereinbarungen sich zwar mit guten Gründen kritisch hinterfragen lässt, von der allerdings anzunehmen ist, dass sie auch im 4+2-Modell eine Rolle spielen würde. Angesichts geringer Bewilligungsquoten ist nicht damit zu rechnen, dass gleich der erste Drittmittelantrag erfolgreich ist. Solche Anträge müssen aber auch erstmal konzipiert, verfasst und begutachtet werden, im laufenden Semesterbetrieb parallel zu diversen anderen Tätigkeiten. Bis überhaupt der Bescheid über eine Bewilligung oder Ablehnung vorliegt, können Monate vergehen. Und all das soll nach zwei Jahren abgeschlossen sein? Das dürfte in sehr vielen Fällen zeitlich nicht hinhauen.
Aber auch die Forschung selbst dürfte in vielen Fällen nicht in zwei Jahren realisierbar sein. Das gilt insbesondere dann, wenn Forschung eben nicht auf Sicherheit setzt, sondern neue Wege beschreitet. Mit einer zweijährigen Phase, an deren Ende die Ziele erreicht worden sein müssen, werden sich Postdocs zukünftig Verzögerungen noch weniger leisten können. Da ist es nur rational, ein Thema zu wählen, das möglichst wenige Risiken birgt. Dass Postdoc-Forschung zukünftig noch weniger innovativ ist, kann wohl kaum im Sinne der deutschen Wissenschaft sein.
Und schließlich will Forschung publiziert werden, wobei auch Publikationen aller Voraussicht nach Gegenstand der Zielvereinbarung sein dürften. Nun brauchen aber Qualitätssicherungsverfahren wie etwa das Peer Review von Aufsätzen Monate, teils sogar Jahre, bis sie abgeschlossen sind. Es dürfte einige Disziplinen geben, in denen sich selbst die Annahme einer Publikation nicht innerhalb von zwei Jahren realisieren lässt. Es sei denn, Postdocs wählen weniger renommierte Journals, bei denen all das schneller geht – soll das etwa das Ziel sein?
Der Einwand, die Postdocs könnten ja bereits innerhalb der vier Jahre Dinge tun, die später Gegenstand der Zielvereinbarung werden, überzeugt im Übrigen nicht. Denn es ist ja gerade die Pointe einer Zielvereinbarung, dass sie transparente Kriterien festlegt, was in einem klar umgrenzten Zeitraum zu erreichen ist. Wie sollen Postdocs diese Kriterien antizipieren? Was, wenn sie in den vier Jahren auf Tätigkeiten setzen, die dann vom Arbeitgeber gar nicht als Gegenstand der Zielvereinbarung herangezogen werden? Schon jetzt überschlagen sich Postdocs bei dem Versuch, möglichst in allen Bereichen zu punkten. Das würde durch ein solches Modell noch verschärft, gewonnen wäre für Postdocs nichts und dank der Fehlanreize einer zweijährigen Anschlusszusage-Befristung nähme auch die Wissenschaft selbst Schaden.
Diversitätsverhinderer 4+2
Ein besonders gravierendes Gegenargument zum 4+2-Modell ist schließlich, dass es Diversität, an der es im deutschen Wissenschaftssystem ohnehin eklatant mangelt, noch weiter beschneiden würde. Denn es ist der Diversität offenkundig nicht förderlich, die Prekarität der Postdoc-Phase durch vier Jahre Befristungsmöglichkeit ohne jede Perspektive einerseits weiter zu erhalten, und durch die Kürzung dieser Phase auf vier Jahre andererseits den Druck auf die Postdocs zusätzlich zu erhöhen. Eine Vier-Jahres-Befristung ohne Perspektive vereint das Schlechte aus zwei Welten: Sie schafft keine Anreize für Arbeitgeber, Perspektiven zu schaffen, und verringert die Zeit, in der sich Postdocs für die viel zu wenigen vorhandenen Perspektiven aufstellen müssen. Es bleibt also mit 4+2 dabei, dass Arbeit in der deutschen Wissenschaft prekär ist und diejenigen, die sich diese prekäre Beschäftigung nicht leisten können oder wollen, außen vor bleiben. Der zunehmende Zeitdruck des 4+2-Modells wird dies sogar noch verstärken: 4+2 privilegiert diejenigen, die es sich leisten können, vier Jahre unter Hochdruck zu arbeiten und anschließend dennoch mit hoher Wahrscheinlichkeit aus dem System zu fliegen. Wer Diversität fördern will, muss für frühzeitige Perspektiven auf eine unbefristete Beschäftigung sorgen. Das klappt nur, wenn ein echter Anreiz besteht, dass nach einer Befristung ohne Anschlusszusage auch eine Beschäftigung mit einer solchen Zusage folgt.
2+4, das rat ich Dir
Im Lichte dieser Erwägungen bleibt nur, das folgende Fazit zu ziehen: An der Maßgabe, mehr Stellen frühzeitig unbefristet zu vergeben in einem fächerspezifisch sinnvoll ausgestaltbaren Modell, das die wissenschaftliche Karriere öffnet für die, die sich prekäre Beschäftigung und Unsicherheit nicht leisten können, scheitert das 4+2-Modell krachend. Aus diesem Grunde sei den Beteiligten der Debatte erneut das 2+4-Modell ans Herz gelegt, das die genannten Anforderungen erfüllen kann: Die Phase vor der Anschlusszusage wird hier so kurz wie möglich gehalten. Unsicherheit wird so nicht nur zeitlich verkürzt, sondern auch stark abgemildert, weil nach zwei Jahren ein echter Anreiz besteht, eine Anschlusszusage folgen zu lassen. So werden diejenigen, die sich Unsicherheit nicht leisten können, nicht mehr systematisch ausgeschlossen. Zugleich ist in diesem Modell die Zeit verdoppelt, in der die Ziele der Anschlusszusage-Vereinbarung erreicht werden sollen, was realistische Vereinbarungen ermöglicht, die den Spezifika einzelner Fächer angemessen Rechnung tragen. Statt uns weiter mit dem defizitären 4+2-Modell auseinanderzusetzen, sollten wir deshalb konstruktiv darüber sprechen, wie ein 2+4-Modell sinnvoll umgesetzt und in das bestehende Wissenschaftssystem integriert werden kann — nicht zuletzt, um Wissenschaft als Beruf in Deutschland endlich wieder attraktiver zu machen. Das wäre ein echter Gewinn.