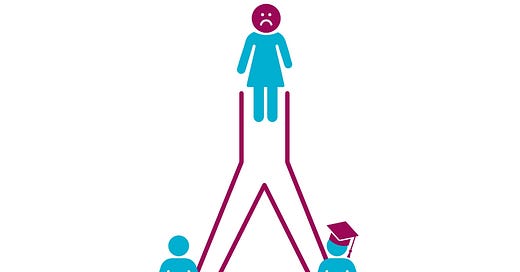Familienfeindliche Hochschulen: Warum die deutsche Wissenschaft umsteuern muss
Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf in der Wissenschaft ist nach wie vor ein großes Thema, denn um es vorsichtig zu formulieren: Da ist noch eine Menge Luft nach oben. Umso erfreulicher, dass dieses Thema gestern auf Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen im Ausschuss für Wissenschaft und Forschung des Abgeordnetenhauses von Berlin diskutiert wurde. Ich war als Anzuhörende mit dabei. Im heutigen Newsletter greife ich die Punkte auf, die ich gestern in meiner Stellungnahme angesprochen habe — sie sind auch bundesweit von Interesse.
Meine Stellungnahme im Berliner Ausschuss: Anschlusszusage abräumen und Mittel kürzen ginge auf Kosten von Teilhabechancen für Sorgearbeitende — und zwar mehrfach
Wir haben mit unserer Initiative #IchBinHanna wiederholt darauf hingewiesen, dass die Arbeitsbedingungen in der deutschen Wissenschaft einige Gruppen besonders hart treffen — dazu zählen Wissenschaftler_innen mit Sorgeverpflichtungen und solche, die erwägen, es zu werden. Insofern ist es aus unserer Sicht äußerst begrüßenswert, dass diese Personen in der gestrigen Ausschusssitzung im Fokus waren.
Dass Familienfreundlichkeit im Hochschulbetrieb eine wichtige Zielsetzung ist, ist inzwischen unbestritten. An den Berliner Hochschulen gibt es verschiedene Maßnahmen, die auf diese Zielsetzung ausgerichtet sind. So sind mehrere Hochschulen durch das audit familiengerechte Hochschule zertifiziert. Unter den Maßnahmen für Familienfreundlichkeit, die die Hochschulen vornehmen, zählen etwa ein familiengerechter Campus, flexible Arbeitszeitmodelle, Kinderbetreuung usw. So begrüßenswert solche Bemühungen ohne Frage sind, reichen sie jedoch bei Weitem nicht aus, um Familienfreundlichkeit auch tatsächlich umzusetzen. Denn ein wesentliches Hindernis für familienfreundliche Hochschulen ist struktureller Natur: Nach wie vor zeichnet sich Arbeit in der deutschen Wissenschaft durch Kettenbefristungen und Perspektivlosigkeit aus. Die daraus resultierende berufliche Unsicherheit hat nachgewiesene negative Effekte auf Wissenschaftler_innen, die Sorgearbeit leisten oder eine Familiengründung erwägen. Ich zitiere dazu aus dem kürzlich erschienenen Bundesbericht Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in einer frühen Karrierephase 2025, kurz BuWiK (der hieß mal Bundesbericht zum wissenschaftlichen Nachwuchs, aber inzwischen wurde verstanden, dass der sogenannte wissenschaftliche Nachwuchs nicht selten schon Kinder auf weiterführenden Schulen hat — oder haben könnte):
„Im Wissenschaftsbereich ergeben sich der Studie zufolge spezifische Vereinbarkeitsprobleme. Zum einen aufgrund der besonderen Arbeitsbedingungen: Eine Vielzahl der Beschäftigungsverhältnisse sind befristet, was zu beruflichen und privaten Unsicherheiten führt. Zudem ergeben sich hohe zeitliche Beanspruchungen, zum Beispiel durch wenig planbare Arbeitszeiten, und hohe Mobilitätsanforderungen, beispielsweise durch Reisetätigkeiten, Pendeln oder Umzüge. Zum anderen entstehen der Studie zufolge Vereinbarkeitsprobleme aufgrund der spezifischen Karrieredynamiken: So zeigen die Auswertungen, dass hohe Karriereanforderungen und der Wettbewerb mit Kolleginnen und Kollegen von Promovierten innerhalb des Wissenschaftssystems besonders häufig genannt werden. Erklärt wird dies in der Studie damit, dass aus der Konkurrenzsituation um die wenigen begehrten Professuren oder um andere attraktive Dauerstellen der Druck entstehen kann, sich ein (inter-)nationales Netzwerk aufzubauen, viel zu publizieren und Drittmittel einzuwerben. Familiäre Verpflichtungen und familienbedingte Erwerbsunterbrechungen werden hier teils als hinderlich empfunden und somit insgesamt als gefährdend für die berufliche Karriere wahrgenommen.“ (S. 206)
Will der Wissenschaftsstandort Berlin seiner Verantwortung gerecht werden, bedarf es daher struktureller Veränderungen, um die Gründe zu beheben, die Familienfreundlichkeit im Hochschulbetrieb unterminieren. Berlin hatte mit der Anschlusszusage-Regelung im Berliner Hochschulgesetz einen vorbildlichen Schritt in diese Richtung getan — nun aber steht diese Regelung auf der Kippe. Das ist nicht nur ein fatales Signal an Wissenschaftler_innen, besonders diejenigen mit Sorgeverpflichtungen, mit entsprechenden negativen Folgen für die Attraktivität des Wissenschaftsstandorts Berlin (wobei diese Attraktivität durch die angekündigten Kürzungen ohnehin schon stark gelitten hat, dazu gleich mehr). Die Anschlusszusage zurückzunehmen hat zudem substantielle Auswirkungen auf die Vereinbarkeit von Familie und Beruf für wissenschaftliche Beschäftigte an den Berliner Hochschulen. Ich kann daher nur nachdrücklich dazu aufrufen, diese Regelung nicht zu kassieren, sondern umzusetzen.
Und die geplanten Kürzungen in Berlin? Von denen sind die Hochschulen massiv betroffen. Sie schaden der Stadt als Wissenschaftsstandort generell. Sie treffen aber Wissenschaftler_innen mit Sorgeverpflichtungen und andere im aktuellen Wissenschaftssystem benachteiligte Gruppen mit zusätzlicher Härte. Denn diese Gruppen sind besonders auf Nachteilsausgleiche und Zusatzangebote angewiesen, die durch geringere finanzielle Spielräume unter Druck geraten.
Es gibt aber noch einen weiteren Grund, warum die Kürzungen Gerechtigkeit und Vielfalt im Hochschulwesen bedrohen: Wissenschaft, Kunst und Kultur gehören mit ihrem kritischen Impetus zum Bollwerk unserer Demokratie. Diesen Bereichen Mittel zu kürzen ist in diesen Zeiten, in denen unsere Demokratie akut bedroht ist, brandgefährlich. Es ist unsere Demokratie, die Vielfalt schützt. Sie gibt dem Anliegen, Gerechtigkeit und Teilhabechancen sicherzustellen, die nötige Basis — an Hochschulen und darüber hinaus. Den Hochschulen Mittel zu streichen gefährdet nicht nur die Berliner Wissenschaft, im Besonderen deren Angehörige mit familiären Verpflichtungen und anderen Zusatzanforderungen. Es gefährdet unsere Demokratie als Ganzes. Will der Berliner Senat seiner Verantwortung für Demokratie und Wissenschaft gerecht werden, muss er hier dringend umsteuern.
Familienfreundlichkeit als Prüfstein für gute Arbeitsbedingungen in der Wissenschaft, nicht nur in Berlin
Rückschritte treffen oftmals zuerst die ohnehin Benachteiligten — damit ist auch im Hinblick auf die Berliner Wissenschaft zu rechnen. Umgekehrt zeigt sich am Umgang eines (Wissenschafts-)Systems mit denjenigen, die vor zusätzlichen Hürden und Anforderungen stehen, wie es in diesem System insgesamt um gute Arbeits- und Lebensbedingungen bestellt ist: Diejenigen, die ohne Zusatzherausforderungen wie Sorgeverpflichtungen im System unterwegs sind, mögen zwar bessere Möglichkeiten haben, die perspektivlose Befristung in der Wissenschaft übergangsweise zu kompensieren. Das setzt allerdings die entsprechenden persönlichen Voraussetzungen dafür voraus. Wer nicht auf Rücklagen oder finanzielle Unterstützung durch Partner_innen oder Familie zurückgreifen kann, wessen Aufenthaltstitel am Arbeitsvertrag hängt usw., wird es hier ebenfalls schwer haben. So trifft die prekäre Situation letztlich sämtliche Wissenschaftler_innen — einige jedoch besonders hart.
Eine Verbesserung der Bedingungen wäre für alle wünschenswert: Die Entscheidung für Wissenschaft als Beruf darf nicht davon abhängen, ob man die Probleme der prekären akademischen ‚Karriere‘ kompensieren kann oder will. Anderenfalls ist auch die sogenannte „Bestenauslese“ nichts als eine Illusion, weil im aktuellen System viele gute Leute der deutschen Wissenschaft gezwungenermaßen oder aus freien Stücken den Rücken kehren. Beides ist offenkundig nicht wünschenswert. Deutschland täte gut daran, Bedingungen zu schaffen, die Wissenschaft als Beruf wieder attraktiv machen und die Wissenschaftler_innen nicht vor die Wahl stellen, ob sie diesen Beruf ausüben oder eine Familie gründen wollen. Dass nur 6,5% der befristet in der Wissenschaft tätigen Hochschulabsolvent_innen unter 35 Kinder haben, während in der gleichaltrigen Vergleichsgruppe aus der freien Wirtschaft ganze 20% Eltern sind, sollte deutlich machen, wie groß das Problem ist. Ein Problem, das (nicht nur) Berlin in den Griff bekommen muss, will es als Wissenschaftsstandort zukunftsfähig aufgestellt sein. Und das geht am einfachsten und mit der größten Breitenwirkung durch mehr unbefristete Stellen neben der Professur und bessere, das heißt vor allem auch: frühere Planbarkeit wissenschaftlicher Karrieren. Den anderen Bundesländern ist ebenfalls dazu zu raten, dass sie anlässlich der angeführten Zahlen die Arbeitsbedingungen in der Wissenschaft nochmals überdenken — und mittels geeigneter gesetzlicher und finanzieller Rahmenbedingungen sicherstellen, dass die mangelnde Vereinbarkeit von Wissenschaft und Familie möglichst bald der Vergangenheit angehört.