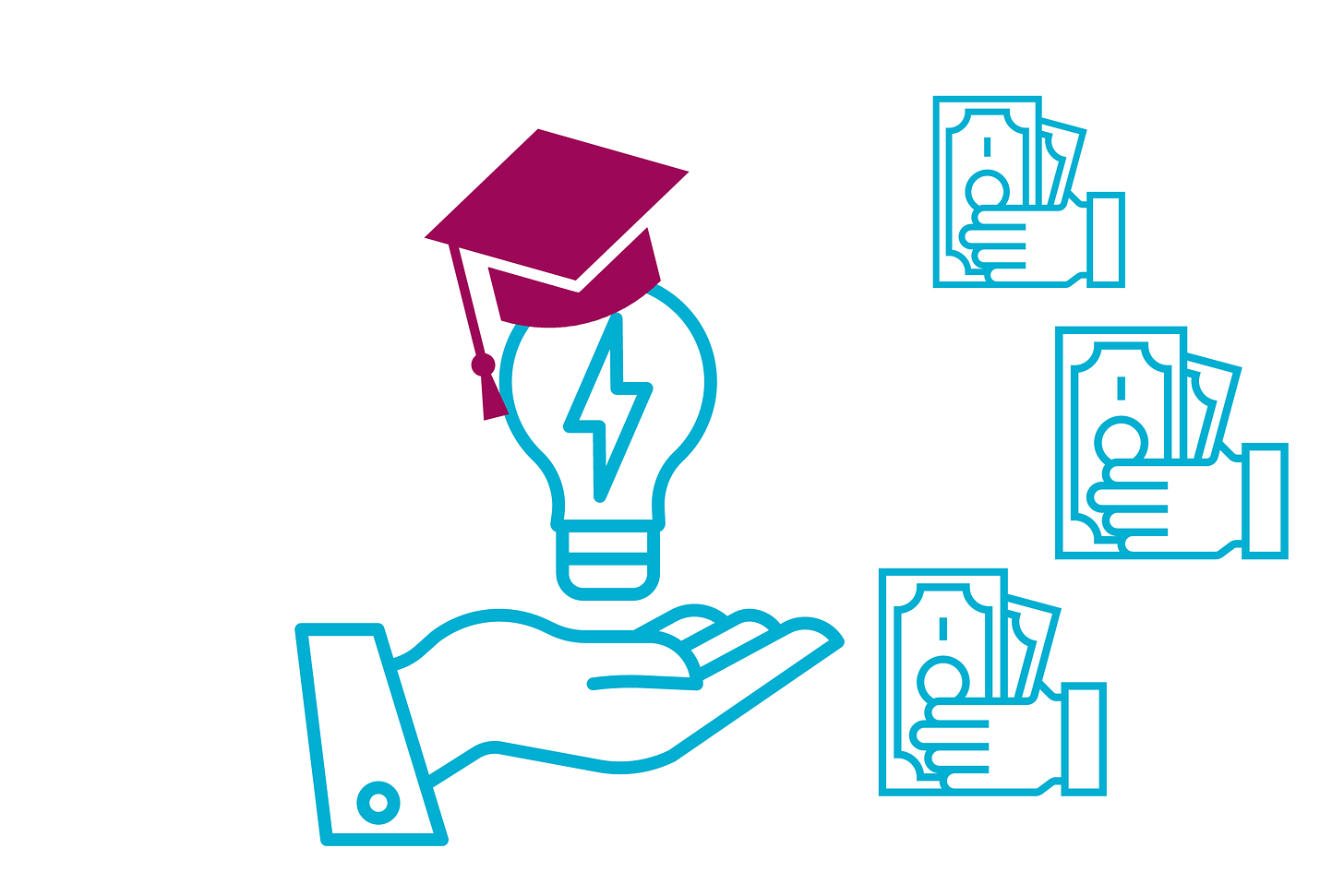Forschungsförderung am Projekt ausrichten – nicht umgekehrt!
Vergangene Woche erreichte uns die Nachricht, dass ein Antrag für ein gemeinsames Forschungsprojekt, den ich zusammen mit Kollegen eingereicht hatte, nicht bewilligt wurde. Auf das große Bedauern, dass aus dem Projekt vorerst leider nichts wird und dass mehrere arbeitsintensive Schleifen der gemeinsamen Konzeption und Ausarbeitung des Antrags umsonst waren, folgte recht unmittelbar ein Gedanke, der einigen Leser_innen durchaus vertraut sein dürfte: Wie könnten wir den Antrag so umarbeiten, dass er für ein anderes Förderformat bei einer anderen Förderinstitution passt? Angesichts der oftmals eher überschaubaren Wahrscheinlichkeit, mit einem Antrag Erfolg zu haben, kennen sicher viele Wissenschaftler_innen diesen Gedankengang allzu gut. Warum ein solches Antrags-Recycling, an das wir uns längst alle gewöhnt haben, unnötigerweise enorm viel Arbeitszeit kostet, inwiefern das Zuschneiden von Projekten auf Förderlinien falsche Anreize setzt, statt aus wissenschaftlicher Sicht optimal ausgestaltete Projektförderung zu gewährleisten — und wie es anders ginge: Darum geht’s im heutigen Newsletter.
Anträge recyclen für die Ethik des Recyclings
Beginnen möchte ich mit einem persönlichen Einblick in den Zeitfresser der Antragsumarbeitung (den ich vor einer Weile in Teilen schon mal als Twitter-Thread geteilt habe). In den Jahren 2019 und 2020 habe ich eine Reihe von Versuchen unternommen, für ein Projekt — in diesem Fall eine ‚Nachwuchs‘-Forschungsgruppe zur Ethik des Recyclings — eine Förderung zu erhalten. Wobei: Ein Projekt? Eigentlich waren es mehrere, denn sie waren alle unterschiedlich ausgestaltet, was das Fördervolumen, die disziplinäre und personelle Zusammensetzung der Forschungsgruppe, ihre Ausrichtung etc. betrifft. Das lag schlicht und ergreifend daran, dass jede Förderlinie andere Vorgaben hatte, angefangen mit dem Budget: Knapp 2 Millionen Euro habe ich beim BMBF im Rahmen der Sozial-ökologischen Forschung beantragt. Knapp 1 Million bei der Robert-Bosch-Stiftung. Ca. eine halbe Million bei der VolkswagenStiftung in der Förderlinie Freigeist (die es inzwischen nicht mehr gibt).
Natürlich wechselt auch die Sprache: Deutsch fürs BMBF, Englisch für die Bosch-Stiftung, sowohl Deutsch als auch Englisch für die VolkswagenStiftung. Ja, es gab auch damals schon Hilfe durch Tools wie DeepL. Aber: Substantielle Antragsteile recyceln ging überwiegend nicht einfach durch bloßes Übersetzen, weil so unterschiedliche Dinge gefragt waren. Das BMBF wollte ein Projekt, das auch außerwissenschaftliche Akteur_innen einbezieht (Stichwort „transdisziplinär“). Die Bosch-Stiftung verlangte einen Fokus auf „developing and emerging countries“. Die VolkswagenStiftung hingegen suchte nach einem ungewöhnlichen und risikobehafteten Forschungsvorhaben jenseits des Mainstreams. Für sich genommen haben alle diese Anforderungen ihre Berechtigung. Aber sie (und viele weitere, die zu nennen hier den Rahmen sprengen würde) machen es nun mal erforderlich, das geplante Vorhaben stets aufs Neue anders zuzuschneiden.
Die ewige Wiederkehr des nicht ganz Gleichen
So schrieb ich also 2019 eine BMBF-Projektskizze, die abgelehnt wurde. Ich reichte einen Vorantrag bei der Bosch-Stiftung ein, der erfolgreich war, ich landete damit auf der Shortlist; in der Folge schrieb ich einen Vollantrag und bereitete mich auf die Präsentation meines Projekts vor einem interdisziplinären Panel vor. Außerdem schrieb ich parallel noch meinen Antrag für ein Freigeist-Fellowship. Am Ende dieses Antragsmarathons für die Ethik des Recyclings stand leider keine Bewilligung; auch der deutlich überarbeitete Vorantrag, den ich 2020 in derselben Förderlinie der Bosch-Stiftung einreichte, war nicht erfolgreich. (Das waren übrigens nicht die einzigen Anträge, die ich in diesen Jahren verfasst habe, hinzu kamen u.a. Anträge um Eigenmittel meiner damaligen Uni; die Probleme der kompetitiven Vergabe solcher Mittel verdienen eine eigene Newsletter-Ausgabe).
Es dürfte nicht überraschen, dass mich das Antrags-Recycling extrem viel Arbeitszeit gekostet hat. Und so geht es zahlreichen Wissenschaftler_innen — nicht nur denen, mit denen ich in den genannten Förderlinien 2019 und 2020 um die jeweiligen Mittel konkurriert habe, sondern einer immens großen Zahl erfolgloser Antragsteller_innen, die ihr Glück mittels Antrags-Recycling in anderen Förderlinien versuchen. Zur generellen Kritik am ausufernden Drittmittelwesen muss insofern noch ein spezieller Kritikpunkt hinzutreten: Die Art und Weise, wie die Drittmittelallokation derzeit organisiert ist, ist defizitär — und das liegt nicht zuletzt an den Fehlanreizen, die diese Form der Organisation setzt.
Was nicht passt, wird passend gemacht – auch, wenn die Gründe die falschen sind
Denn: Statt die Projekte in erster Linie zweckdienlich für die Bearbeitung des jeweiligen wissenschaftlichen Themas zu gestalten, müssen zunächst einmal die Kriterien der Förderlinien erfüllt werden. Das betrifft das maximale Fördervolumen, die Laufzeit der Projekte, ggf. die Beteiligung der Disziplinen sowie außerwissenschaftlicher Partner_innen usw. Nicht selten dürfte etwa das maximale Fördervolumen möglichst ausgereizt werden (mir wurde sogar mal gesagt, dass es Förderchancen senke, wenn man das nicht praktiziere) — können maximal 500.000 € beantragt werden, dürften viele Anträge für Projekte eingehen, die Summen à la 498.987 € als erforderliches Budget angeben. Das zeigt exemplarisch, dass es sehr viel sinnvoller sein dürfte, das Ganze umzudrehen: Wissenschaftler_innen konzipieren zunächst ein aus wissenschaftlicher Sicht sinnvolles Projekt, legen eine dafür angemessene Laufzeit fest, geben an, welche Wissenschaftler_innen und Disziplinen, Reisemittel, Budgets für Geräte usw. dafür benötigt werden. Und das wird dann so gefördert, sofern es die zuständigen Gutachter_innen und Entscheider_innen einer daran interessierten Förderinstitution überzeugt.
Zwei Argumente sprechen dafür, so vorzugehen: Erstens müssen Forschungsprojekte auf diese Weise nicht in ein Korsett aus Vorgaben gezwängt werden, von denen manche oder gar einige dem Vorhaben möglicherweise gar nicht zuträglich sind oder es sogar ausbremsen. Und zweitens sparen wir uns enorm viel Zeit für die Umarbeitung abgelehnter Anträge, die an anderer Stelle neu eingereicht werden.
Förderinstitutionen bewerben sich bei Antragsteller_innen über eine übergreifende Plattform
Aber wie könnte diese alternative Art der Forschungsförderung organisiert werden? Dazu hatte ich vor einem Jahr schon einmal einen Vorschlag auf Twitter gemacht:
Klar, einige offene Fragen wären dazu noch zu klären. Etwa, ob die auf der Plattform vorgestellten Vorhaben öffentlich einsehbar sein sollten (solange Reputation in der Wissenschaft auch mit originellen Ideen und deren Umsetzung erlangt wird, könnte der Schutz vor ‚Projektdiebstahl‘ hier bedenkenswert sein). Auch eine Anonymisierung der Wissenschaftler_innen zumindest für den ersten Schritt des Verfahrens wäre eine Überlegung wert, zum Beispiel, um sicherzugehen, dass nicht der Matthäus-Effekt greift (wer schon viele Drittmittel hat, erhält noch mehr). Zudem fragt sich, für welche Förderinstitutionen eine solche Plattform offen sein sollte und welche Einschränkungen hier sachgerecht wären.
Es braucht eine Diskussion über diese und weitere Fragen, um die Umstellung der Forschungsförderung tatsächlich so zu gestalten, dass sie für Wissenschaft, Wissenschaftler_innen und Förderinstitutionen sinnvoll ist. Wir sollten diese Diskussion aber nicht scheuen — denn eine solche Umstellung, die den tatsächlichen wissenschaftlichen Projekterfordernissen den Vorrang gegenüber anderen Kriterien gibt, könnte sich als echter Gewinn erweisen für die Förderung von Forschung in Deutschland.