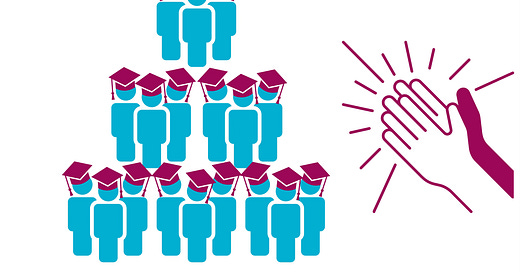Was ist eigentlich ein Spitzenforscher? Nun, so viel ist klar: Ein Spitzenforscher ist einer, den man gewinnen will — für das nationale Wissenschaftssystem, die eigene Uni oder Forschungseinrichtung. Zuletzt hatte Bundesforschungsministerin Doro Bär den Begriff bemüht, um „Spitzenforschern“ aus den USA ein „Rundum-Sorglos-Paket“ in Aussicht zu stellen. Diese Ankündigung warf in der deutschen Wissenschaftscommunity einige Fragen auf. Darunter zunächst die, warum in Deutschland ausgebildete Wissenschaftler_innen hier stattdessen ein „Rundum-Sorgenvoll-Paket“ erwartet, in dem zahlreiche Kettenverträge, Phasen der Erwerbsarbeitslosigkeit und für die allermeisten ein Rauswurf aus der Wissenschaft mit Anfang/Mitte 40 stecken. Auch stellte sich vielen die Frage, wie die große Anwerbeoffensive in Zeiten allgegenwärtiger Kürzungen eigentlich nachhaltig finanziert werden soll. Doch treten wir noch einen Schritt zurück: Schon allein der Begriff des Spitzenforschers ist hochproblematisch. Er lebt nämlich davon, das Gros der Wissenschaftler_innen als zweitklassig zu degradieren und arbeitet zugleich einem Geniekult zu, der der Arbeitsrealität in der Wissenschaft weder angemessen noch zuträglich ist. Im heutigen Newsletter möchte ich mir diese verschiedenen Aspekte einmal genauer ansehen — und dabei zeigen, wie groß der Schaden ist, den die Rede von Spitzenforschern anrichtet.
Überwiegend Schmalspur-Forscher_innen?! Die inhärente Abwertung der Spitzenforscher-Rhetorik
Mit „Spitzenforschern“ ist es so eine Sache: Wenn man auf Teufel komm raus einzelne Forschende als „spitze“ klassifizieren möchte, dann geht das natürlich nur, indem man gleichzeitig andere abwertet, denn das Bild der Spitze impliziert: Ganz oben ist nicht viel Platz. Um diese Auf- und Abwertung vorzunehmen, braucht man freilich irgendwelche Kriterien (notfalls vorgeschobene) und dürfte so flugs wieder bei denjenigen Metriken landen, die seit geraumer Zeit aus guten Gründen kritisiert werden: Impact Factors, Länge von Publikationslisten, Drittmittelerfolge, Auszeichnungen usw. Längst gibt es einige Bemühungen, von einer Forschungsbewertung abzurücken, die sich an derlei quantitativen Kriterien von fragwürdiger Aussagekraft berauscht. Jedoch wäre bei denen, die „funkelnde Augen“ bekommen angesichts der heißgeliebten Spitzenforscher, einmal kritisch nachzufragen, worauf sich ihre Liebe da eigentlich richtet: Was macht bloße Forscher denn nun zu Spitzenforschern? Mein Verdacht: Alternative Forschungsbewertung steht da weniger im Fokus — es dürfte weiterhin um das Prestige gehen, das bestimmte Forschende mitbringen, das nach wie vor primär durch Kriterien wie die oben genannten zustande kommt und von dem sich Deutschland und seine blassen Wissenschaftsinstitutionen erhoffen, dass es auf sie abfärben möge.
Ein gravierendes Problem mit der Rede von Spitzenforschern bestünde allerdings auch dann fort, wenn es gelingen sollte, den Quantifizierungsfetisch beiseitezulegen und stattdessen andere Kriterien anzulegen. Denn von Spitzenforschern zu sprechen ist überhaupt nur möglich, wenn man ein (mindestens) zweiklassiges System der Forscher_innen-Community annimmt: Da gibt es diejenigen, die sogenannte Spitzenforschung betreiben, und eben, nun ja, die ganzen anderen. Genauso wie der „Spitzenforscher“ eine Begriffsbestimmung gut gebrauchen könnte, wäre es interessant zu wissen, ob diejenigen, die mit dem Begriff um sich werfen, eine genauere Vorstellung davon haben, was denn eigentlich die Nicht-Spitzenforscher_innen ausmacht. Ist ihre Arbeit notwendigerweise schlechter als die der Spitzenforscher? Höchstwahrscheinlich lautet die ehrliche Antwort auf diese Frage: Nein, Nicht-Spitzenforscher_innen machen keineswegs schlechtere Arbeit. Sie machen bloß welche, die weniger prestigeträchtig ist, die keine fancy Pressemeldungen generiert, die ganz basal und unspektakulär den Laden am Laufen hält — sei der Laden nun eine Hochschule, eine Forschungseinrichtung oder die deutsche Wissenschaft als Ganzes. Da sind die Wissenschaftler_innen, die Generationen von Studierenden grundlegende Fähigkeiten wie wissenschaftliches Arbeiten beibringen, einige von ihnen auf Hochdeputatsstellen mit enorm hoher Lehrbelastung. Sie können das noch so brillant und mitreißend tun (so mitreißend es eben bei derart trockener Materie möglich ist): Ich bezweifle, dass ihnen das jemals das Label „Spitzenforscher_in“ einbringen würde. Ja nun, mag man einwenden, Lehre ist eben nicht gleich Forschung und hier geht es ja um Spitzenforschung, nicht um Spitzenlehre! Dieser Einwand ist berechtigt (und zugleich vielsagend, was den Stellenwert der Lehre im Gesamtgefüge wissenschaftlicher Arbeit anbelangt). Doch auch Forschung besteht nicht immer aus bahnbrechenden Erkenntnissen und euphorischem „Heureka“-Schreien. Sie ist in weiten Teilen Fleißarbeit, setzt sich nicht selten aus Versuchen zusammen, die scheitern, sie ist im Regelfall überhaupt nicht glamourös, sondern einfach Teil eines ganz normalen Berufs (auch, wenn uns weiterhin bestimmte Leute glauben machen wollen, Wissenschaft sei „etwas Besonderes“ — in der Hoffnung, dass wir dann auch die besonders schlechten Arbeitsbedingungen einfach hinnehmen).
Dass wir überhaupt einzelne Forschende mit Ausdrücken wie „Spitzenforscher“ überhöhen, übersieht aber nicht bloß, dass es diverse wichtige, ja, unentbehrliche Tätigkeiten im Wissenschaftsbetrieb gibt, für die diejenigen, die sie ausführen, keinen Applaus bekommen — und seien sie auch noch so gut darin. Es gerät dabei noch etwas anderes aus dem Blick: Sogar dann, wenn in einer Gruppe von Forschenden alle dieselbe Art von prestigeträchtiger Tätigkeit exakt gleich gut ausführen würden, zwingt die Auszeichnung einzelner Forschender als „spitze“ dazu, andere durch den Verzicht auf eine solche Auszeichnung abzuwerten. Das bringt diese Rhetorik inhärent mit sich — genauso wie es die der „Bestenauslese“ tut: Muss es ums Verrecken die „Besten“ geben, die sich von anderen abheben, so muss man nun einmal Qualitätsunterschiede zu den anderen ausmachen — und seien sie noch so winzig oder bei näherer Betrachtung gar irrelevant oder fehlgeleitet —, damit die als die „Besten“ Identifizierten irgendwie herausstechen können.
Vor allem aber ist Forschung keine „one man show“, bei der nur wenige Spitzenleute Anerkennung verdienen. Es ist einiges dran an der Idee, dass wir als Forschende „auf den Schultern von Riesen“ stehen: Hinter jedem „Spitzenforscher“ stehen zig Wissenschaftler_innen, die einfach ihre Arbeit machen — bzw. sie gemacht haben, solange sie es konnten. Weil jedes Puzzleteil für den Erkenntnisprozess wichtig ist (übrigens auch die Teile, die mangels Passung wieder verworfen werden), ist es ein künstlicher Vorgang, einzelnen Personen den vollen Credit für eine Erkenntnis zu geben und dabei großzügig auszublenden, wie viele Vorarbeiten dafür von anderen, unsichtbaren Forschenden (hier insbesondere: Forschenden aus marginalisierten Gruppen) geleistet werden mussten — oft sogar im unmittelbaren Umfeld der sogenannten Spitzenforscher. Das führt zu einem weiteren Problem mit folgenschweren Implikationen: Geniekult.
Hauptsache, die Forschung ist spitze: Genies dürfen alles!
Spitzenforscher erscheinen in den Erzählungen deutscher Wissenschaftsfunktionäre regelmäßig als die Helden, die das deutsche Wissenschaftssystem endlich nach vorne bringen sollen, auf dass es mit den Ivy-League-Unis in den USA (in ihrer Verfasstheit vor Trumps Wissenschaftszerstörungsprojekt) mithalten möge. Julika Griem hat in ihrer Keynote beim Forum Wissenschaftskommunikation 2018 bedenkenswerte Kritik an derartigen Heldenerzählungen geübt — sie bezog sich dabei zwar auf Wissenschaftskommunikation, aber ihre Analysen sind auch für unser Thema aufschlussreich. Da wäre etwa die Frage, wer eigentlich den heldenhaften Aufstieg zum Spitzenforscher meistern kann. Zu denen, die sich überhaupt als wissenschaftliche Helden auf die Jagd nach Erkenntnissen machen können, schreibt Griem:
„Helden können nur wenige sein; als Abenteuer ist Wissenschaft […] ein Privileg weniger und damit schwer demokratisierbar. Um es weiter zuzuspitzen: Das Glück der Jagd war schon immer das Glück derjenigen, die daran teilhaben durften. […] Abenteuer sind nicht inklusiv.“
Entsprechende Semantiken von Abenteuern und Jagd nach Erkenntnis seien „männlich codiert“, während die Sorgfalt, die es für wissenschaftliche Fortschritte genauso braucht, eher „eine weibliche Aura“ habe. Vor diesem Hintergrund halte ich es keineswegs für einen Zufall, dass von „Spitzenforschern“ regelmäßig in der nicht gegenderten Variante die Rede ist: Solche Genies sind eben naturgemäß nur Männer, so eine verbreitete Annahme.
Und noch eine weitere Passage in Griems Keynote ist erhellend, wenn es darum geht, den Geniekult in der Wissenschaft, der in der Rede vom Spitzenforscher weiter kultiviert wird, kritisch zu hinterfragen:
„Klassische Helden bringen sich gern gegen [die] Dimension des Sozialen und Gesellschaftlichen in Stellung — ihr Ruhm zehrt von dem Ruf, ganz allein aufgebrochen zu sein. Dieser Mythos lebt fort in Selbstbeschreibungen von Wissenschaftlern, die — interessanterweise genau wie ihre wissenschaftsfeindlichen Kritiker — anti-institutionelle Affekte mobilisieren.“
Genies können sich alles erlauben, auch und gerade in der Wissenschaft. Wer Spitzenforschung betreibt, darf sich offenbar gegenüber seinen Mitmenschen maximal danebenbenehmen (bis hin zu strafrechtlich relevanten Formen von Machtmissbrauch), ohne fürchten zu müssen, dass die Institutionen, deren Regeln dabei missachtet werden, ernsthaft dagegen vorgehen — das zeigen viele schockierende Fälle, die in den letzten Jahren medial an die Öffentlichkeit gelangt sind. Dies ergibt sich schon daraus, dass Präsidien und Rektorate den dekoriertesten Vertreter_innen ihrer Institution nicht auf die Füße treten wollen — zumal, wenn diese über Drittmittel dringend benötigte Gelder ins Haus holen. Die Verachtung institutioneller Strukturen, die so manchem Genie eignet, ist sicher auch dem Wissen darum geschuldet, dass für jemanden, der „genial“ ist, die Regeln eben nicht in der gleichen Weise gelten — oder zumindest nicht durchgesetzt werden. Es sind solche Missstände, die man weiter befeuert, hält man an der Fetischisierung von „Spitzenforschern“ fest.
Anerkennung für Wissenschaftler_innen, die einfach ihre Arbeit machen
Es wird Zeit, die künstliche Differenzierung aufzugeben zwischen Spitzenforschern einerseits, die bestmögliche Bedingungen verdienen und um die man wie im Wahn wirbt, und Normalforscher_innen andererseits, die man mit prekären Bedingungen abspeist. Stattdessen gilt es, Wissenschaft endlich als das Gemeinschaftsprojekt anzuerkennen, das sie nun einmal ist. Auch dazu findet Julika Griem treffende Worte:
„Forschung funktioniert […] in vielen Fällen gerade nicht als individuell zuschreibbare und die Mühen des alltäglichen Weitermachens überstrahlende Einzelleistung. […] Es geht also auch […] um die Berücksichtigung von Details in immer kleinteiligeren und arbeitsteiligeren organisatorischen Komplexen. Und es geht vor allem um die Sorgfalt, die gerade auch für unspektakuläre Phänomene aufgebracht werden muss, um wissenschaftliches Wissen methodisch nachvollziehbar legitimieren zu können.“
Statt also das Gros der Forschenden systematisch abzuwerten, um vermeintlichen Spitzenforschern übertriebenen Applaus zu zollen, stünde es deutschen Wissenschaftsfunktionären gut zu Gesicht, sich auf das Alltägliche von Wissenschaft als Beruf zurückzubesinnen. Auf das Mühselige, Langweilige, das, was geschehen muss, damit es voran gehen kann und ohne das Ergebnisse, die man für Spitzenforschung halten möchte, gar nicht erst möglich wären. Dafür verdienen alle Beteiligten Anerkennung — und zwar nicht bloß durch Applaus, sondern in erster Linie durch faire Arbeitsbedingungen in der Breite. Ohne die werden zuallererst die weniger spektakulären Aspekte wissenschaftlicher Arbeit bedroht — und damit gerät die Wissenschaft mitsamt ihrer „Spitzenforschung“ als Ganze ins Wanken. An die Spitze wissenschaftlicher Erkenntnis gelangen wir nur gemeinsam, und dazu muss zunächst der Berg aus all den Aufgaben bewältigt werden, die diejenigen Wissenschaftler_innen erledigen, die einfach bloß ihre Arbeit machen — ohne je die Möglichkeiten zu erhalten, sich als herausragende Gipfelstürmer_innen zu gerieren. Denn wenn überhaupt jemand den Titel „Spitzenforscher_innen“ verdient, dann sind es all die Wissenschaftler_innen, die zahlreiche unverzichtbare Dinge tun und dabei oft genug auf jeden Dank verzichten müssen. All das zu tun, ohne dafür im Rampenlicht zu stehen, ausgiebig gebauchpinselt und umfänglich belohnt zu werden: Das ist wahrhaft spitzenmäßig.