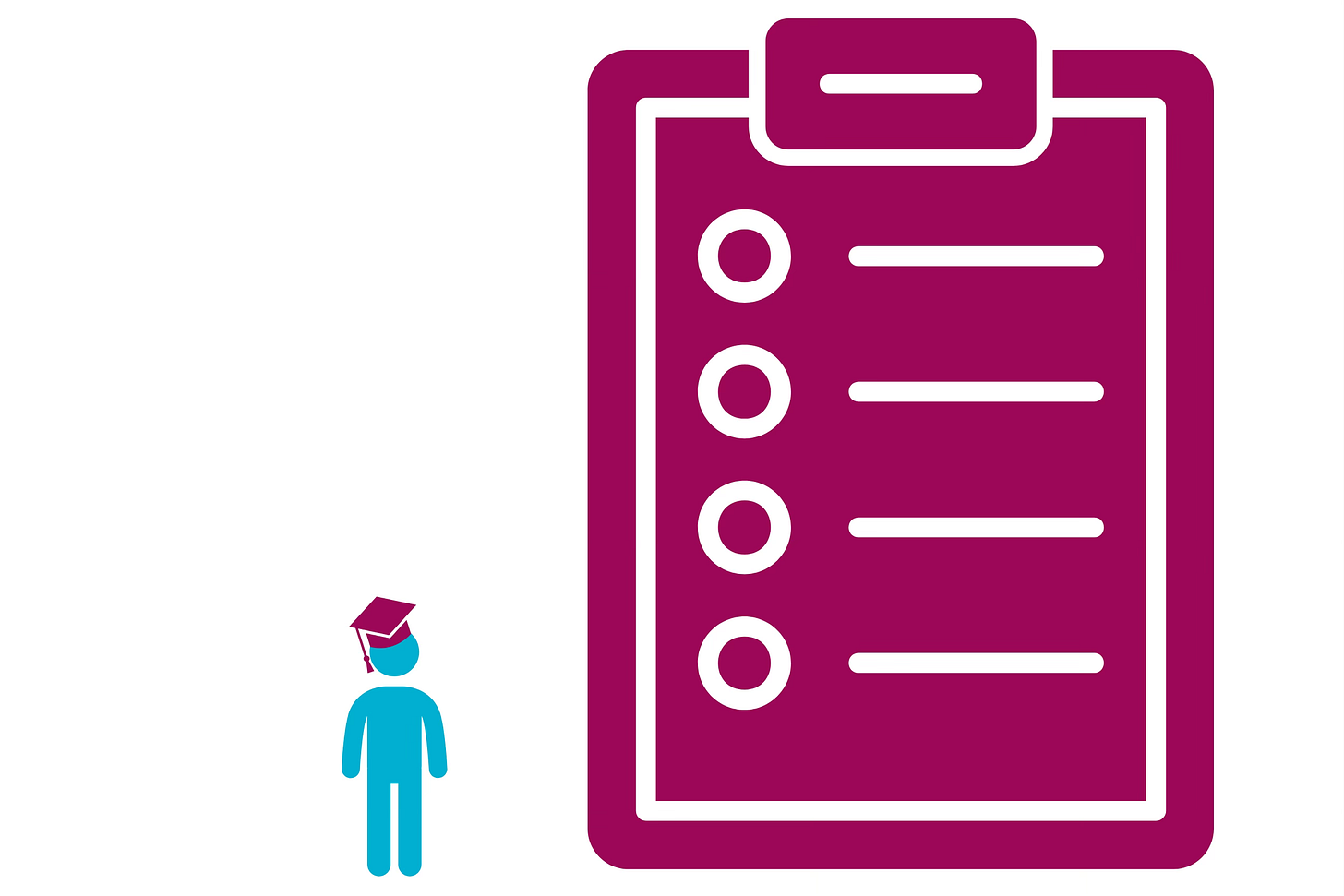Wissenschaft als Beruf: Dauerzustand Kontrollverlust
Während ich diese Zeilen tippe, sitze ich im Zug. Einem IC auf dem Weg nach Köln. Es ist voll, und die anderen Fahrgäste sind in bester Freizeitstimmung, was zu beachtlichen Lautstärken führt, die auch die effizientesten Noise-Cancelling-Kopfhörer an ihre Grenzen bringen. Eigentlich wollte ich einen anderen Zug nehmen, aber der kam nicht, womit ich bereits beim Thema des heutigen Newsletters bin: Wer mit Zügen pendelt — und das tun in der Wissenschaft einige —, gibt spätestens mit Betreten des Bahnsteigs jede Kontrolle über den Verlauf der weiteren Stunden ab und legt sein Schicksal in die Hände der Deutschen Bahn. Die Erfahrung zeigt: In diesen Händen ist es mäßig gut aufgehoben. Für Zugfahrtage Pläne machen kann man in aller Regel knicken. Sich darauf verlassen, im Zug vernünftig arbeiten können, grenzt an Realitätsverweigerung. Aber nicht nur die Pendelei entzieht uns die Kontrolle über unser wissenschaftliches Arbeitsleben — und ja, das private ebenso. Während ich gerade in einer leicht dunstigen Bierwolke sitzend gegen Gespräche über Winterstiefel und Hackfleischgerichte anschreibe (soeben läuft ein Herr mit fünf leeren Pilsflaschen an mir vorbei, es ist kurz nach 11 am Vormittag), fluten die erwartbar zahlreichen E-Mails zum Wochenbeginn mein E-Mail-Postfach, und ich gebe es unumwunden zu: Ich habe schon längst die Kontrolle über meine Mails verloren. Es sind einfach zu viele, in zu vielen Angelegenheiten. Ich freue mich inzwischen frenetisch über jede Mail, die nicht geschrieben wird, denn schon der Versuch, den Inhalt aller in der Woche eingehenden Mails überhaupt nur zur Kenntnis zu nehmen, bringt mich an meine Grenzen. Gleichzeitig jongliere ich mit allerlei Deadlines, Verpflichtungen, Terminen und Erwartungen, mit studentischen Arbeiten und meiner Lehre — und es gelingt mir allzu oft nicht, die vielen Bälle aufzufangen, die ich da in der Luft halte. Die Wahrheit ist: Ich schwimme. Und das seit Jahren. Über diesem Kontrollverlust im Kleinen hängt zugleich aber noch ein anderes kontrollverlustiges Damoklesschwert von ungleich ausgreifenderem Ausmaß: der Kontrollverlust im ganz Großen. Denn ich weiß: Mit fast 39 Jahren habe ich nach wie vor extrem wenig Einfluss darauf, ob ich den von mir gewählten und seit nunmehr 12 Jahren ausgeübten Beruf der Wissenschaftlerin langfristig weiter ausüben kann oder nicht. Da geht es mir wie sehr vielen anderen Wissenschaftler_innen in Deutschland. Zeit, sich den permanenten Kontrollverlust einmal genauer anzusehen — und damit auch, was er mit uns und unserer Arbeit macht.
Alles unter Kontrolle?! Niemals!
Ich muss gar nicht erst das vielzitierte John-Lennon-Zitat vom Plänemachen bemühen: Es ist uns allen klar, dass Kontrolle und Planbarkeit des eigenen Lebens generell nur sehr begrenzt drin sind. Das führen uns nicht zuletzt die vielfältigen Krisen eindrücklich vor Augen, mit denen wir gegenwärtig konfrontiert sind. Gleichwohl scheint mir die Wissenschaft ein Berufsfeld zu sein, das den Kontrollverlust auf verschiedenen Ebenen besonders forciert. Denn da ist zunächst die Kombination aus zu vielen Aufgaben und Tätigkeiten, die schier endlose To-do-Listen erzeugt, die prinzipiell unschaffbar sind. Wir alle machen alles Mögliche, und zwar parallel. Wir sind es gewohnt, uns zu viel aufzuhalsen und strampeln uns dann ab bei dem nicht selten verzweifelten Versuch, das Zugesagte zu liefern, die Pflichten zu erfüllen, die Erwartungen nicht zu enttäuschen. Wie kommt das? Sind wir schlicht und ergreifend nicht imstande, uns einen realistischen Arbeitsplan zu machen? Brauchen wir mehr von diesen Zeitmanagement-Workshops, wie sie auch in der Wissenschaft längst allerorten angeboten werden? Müssen wir alle mal ganz kräftig unsere Selbstorganisation durchoptimieren? Sind wir einfach zu verlockt von all den superdupertollen Möglichkeiten, die sich uns bieten, um Vorträge zu halten, Dinge zu publizieren, mit Leuten Drittmittelanträge auszuarbeiten und anderes kollaboratives Zeug zu machen?
Nun, ich möchte nicht bestreiten, dass auf meiner To-do-Liste eine Menge Sachen stehen, die spannend und erfreulich sind, die ich gern machen will und die ich exakt aus diesem Grund da draufgeschrieben habe. Gleichwohl ist das nur ein Teil der Wahrheit. Hier der andere Teil: Sehr vieles zu tun ist ein Versuch, die eigene berufliche Existenz in der Wissenschaft noch etwas länger beibehalten zu können. Es ist der Versuch, in einem unkontrollierbaren System, in dem viel mehr dafür spricht, es verlassen zu müssen, als dafür, drinbleiben zu können, zumindest das Gefühl zu haben: Ich habe alles getan, was ging, um meine Chancen zu erhöhen. Denn ich weiß es und spätestens seit #IchBinHanna Dauerthema ist, steht es uns allen jeden Tag aufs Neue klar vor Augen: Für die allermeisten Wissenschaftler_innen ohne unbefristete Stelle wird der Weg früher oder später aus der Wissenschaft hinausführen, ob sie das nun wollen oder nicht. Dabei ist es völlig egal, welche Abzweigungen sie auf diesem Weg nehmen. Irgendwann reißt das System die entscheidende Brücke ab, die es bräuchte, um das rettende Ufer der Festanstellung zu erreichen. Nur ganz wenige schaffen es hinüber. Die anderen müssen umkehren. Auch, wenn sie zuvor viele Jahre lang einen mühseligen Weg zurückgelegt haben, der allzu oft voller Entbehrungen war.
Kontrollverlust im Kleinen provozieren, um dem Kontrollverlust im Großen Einhalt zu gebieten: Das wird nichts!
Sich tonnenweise Arbeit aufzuladen ist eine beliebte Strategie, um dieser erzwungenen Umkehr auf dem erhofften Weg in Richtung einer langfristigen Perspektive in der Wissenschaft vorzubeugen — oder jedenfalls, um sich subjektiv selbstvergewissern zu können, dass man genau das getan hat. Aber diese Strategie hat eine paradoxe Konsequenz: Gerade weil wir uns selbst dermaßen zuballern mit Dingen, die es zu bearbeiten gilt, erzeugen wir den Kontrollverlust im Kleinen. Wir kommen nicht mehr hinterher, übersehen die wichtige E-Mail, sind mit dem versprochenen Aufsatz in Verzug, die Herausgabe des Sammelbands verzögert sich weiter, wir hetzen von einem Termin zum nächsten und sind froh, wenn wir uns dabei nicht am Brötchen verschlucken, das wir hektisch in uns hineinschlingen, weil die Zeit schon wieder nicht für eine Mittagspause gereicht hat.
An alledem sind mindestens vier Dinge zu bemängeln. Erstens fühlt sich diese Art der Dauerüberforderung, in der sich die Kontrolle ab einem gewissen Punkt kaum noch zurückgewinnen lässt, in aller Regel ziemlich mies an. Das sage ich aus eigener Erfahrung. Ich habe unzählige Nächte wachgelegen und an diese Wand aus Arbeit gedacht, die sich da vor mir auftürmt. Einzelne Ziegelsteine daraus abtragen, selbst die größeren, bringt nur kurzfristig eine Linderung der inneren Unruhe, die der Anblick dieser Wand erzeugt, denn mit jedem Stein, der abgearbeitet wird, kommen neue hinzu. Allzu oft verstellt mir diese gigantische Wand aus zu Erledigendem außerdem den Blick auf das, was mich bewogen hat, sie überhaupt zu errichten: auf die Gründe, aus denen ich mich für Wissenschaft als Beruf entschieden habe. Dauerüberarbeitung gehörte übrigens nicht dazu.
Zweitens wird unsere Arbeitsleistung höchstwahrscheinlich nicht besser, wenn wir sie auf zig kleine Einzelaufgaben aufsplitten. Statt uns auf eine Sache zu fokussieren und ihr unsere gesamte Aufmerksamkeit zu schenken, springt die Aufmerksamkeit ständig hin und her und wir drohen keiner der Aufgaben, die wir dabei bearbeiten, so richtig gerecht zu werden.
Drittens und durchaus damit zusammenhängend provozieren wir, dass nicht nur wir selbst unzufrieden sind, sondern auch viele andere Menschen. Diejenigen nämlich, denen wir Texte in Aussicht gestellt, Antworten auf Mails versprochen, das Erledigen von Aufgaben zugesagt haben. Sind wir mit diesen Dingen in Verzug, geht das allzu oft auch auf Kosten anderer — und wer sich gegenüber den Erwartungen Dritter nicht völlig immunisiert hat, wird schnell feststellen, dass die Enttäuschung der anderen die eigene Unzufriedenheit noch zusätzlich anfacht.
Viertens schließlich wird die Strategie, sich durch die Übernahme einer möglichst großen Anzahl an Aufgaben gegen die Unkontrollierbarkeit der wissenschaftlichen Berufstätigkeit zu wappnen, aller Voraussicht nach nicht aufgehen. Denn die Fäden halten keineswegs wir in der Hand, die wir hoffen, am Ende Teil der Wissenschaft bleiben zu können. Die Kontrolle darüber, ob wir bleiben können oder gehen müssen, obliegt anderen. Und mit ihr im Übrigen auch die Macht über weite Teile unserer To-do-Listen — jedenfalls gilt das für sehr viele von uns. Denn dass wir uns mehr oder minder selbstbestimmt Aufgaben aufhalsen, ist das eine. Selbst das mag sich wenig selbstbestimmt anfühlen, wenn wir als Getriebene eines Systems, das unersättlich eine Leistung nach der anderen einfordert, immer das Gefühl haben, irgendetwas liefern zu müssen. Aber für diejenigen, die Vorgesetzte haben, die ihre To-do-Listen mit befüllen, sieht die Sache noch einmal ganz anders aus.
Ich höre schon den Einwand: Das gibt es in anderen Branchen doch auch! Klar, das steht außer Frage. Aber wer in der Wissenschaft einen befristeten Vertrag hat und eine von Vorgesetzten aufgetragene Aufgabe nicht (zu vollster Zufriedenheit) ausführt, riskiert unter Umständen, dass der Vertrag nicht verlängert wird. Die Möglichkeiten, einer unangemessenen Kontrolle der eigenen beruflichen Tätigkeiten durch Vorgesetzte mittels arbeitsrechtlicher Schutzmechanismen (wie dem Kündigungsschutz in einem unbefristeten Arbeitsverhältnis) einen Riegel vorzuschieben, sind im Wissenschaftssystem deutlich reduziert. Mit anderen Worten: Schreiben Profs ihren Mitarbeiter_innen Aufgaben auf die To-do-Liste (oder streichen welche runter, die die Mitarbeiter_innen eigentlich gern übernommen hätten), so ist es den Mitarbeiter_innen aus strukturellen Gründen nur eingeschränkt möglich, die Kontrolle über die eigene To-do-Liste zurückzugewinnen.
Für einen kontrollierten Ausstieg aus dem Kontrollverlust — und zwar solidarisch!
Vollumfängliche Kontrolle über das eigene Berufsleben gibt es nicht, weder in der Wissenschaft noch anderswo. Aber wir täten gut daran, das Wissenschaftssystem so umzugestalten, dass Kontrollverlust kein Dauerzustand mehr ist. Indem wir uns erstens klar machen, dass es im Zweifel wenig bringt, wenn wir uns mit zig Aufgaben überladen. Denn es ist eine Illusion, damit tatsächlich die Kontrolle über das Wohl und Wehe unserer wissenschaftlichen ‚Karriere‘ zurückerobern zu können. Diese Kontrolle obliegt anderen.
Gibt es mehr langfristige Perspektiven in der Wissenschaft, werden zugleich aber die Möglichkeiten eingeschränkt, in schädlicher Weise Kontrolle auszuüben, wie es im aktuellen Wissenschaftssystem nicht zuletzt durch Machtmissbrauch geschieht. Was wir in positiver Weise kontrollieren können, ist außerdem, ob wir das Spiel des Sich-gegenseitig-Übertrumpfens hinsichtlich der Gesamtzahl unserer To-Do-Listen-Punkte wirklich weiter mitspielen wollen. Je mehr von uns daraus aussteigen, desto weniger unerbittlich werden die Standards sein, an denen wir alle gemessen werden. Diese Möglichkeit sollten wir uns immer klar vor Augen führen, wenn wir drohen, uns in Panik zu verlieren angesichts der Unkontrollierbarkeit unseres beruflichen Daseins: Individuell können wir vieles nicht kontrollieren — wenn wir uns aber zusammenschließen, können wir uns eine Menge Kontrolle zurückholen. Denn: Solidarität ist das beste Mittel gegen einen Kontrollverlust, der von Vereinzelung lebt.